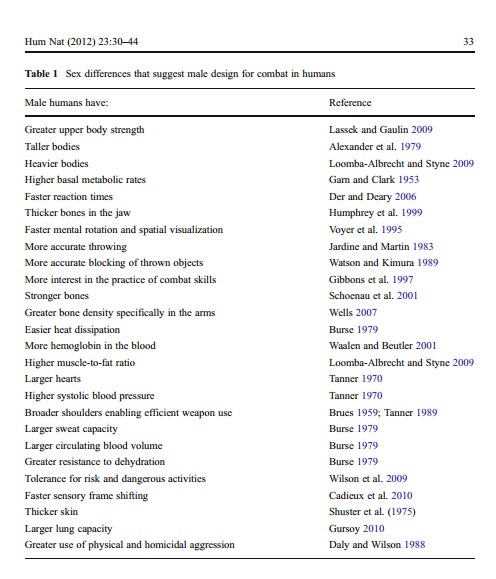Ich denke den Skandal um Rachel Dolezal haben die meisten mitbekommen. Hier eine Kurzfassung aus der Wikipedia:
Rachel Dolezal (auch Doležal geschrieben; * 1977) ist eine amerikanische Akademikerin und Bürgerrechtsaktivistin.
Sie war bis Juni 2015 Lehrbeauftragte (Instructor) für afrikanische und afroamerikanische Studien an der Eastern Washington University, Präsidentin der lokalen Abteilung der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) in Spokane, Washington und Vorsitzende der Ombudsmann-Kommission der Polizei in Spokane.
Im Juni 2015 entstand ein großes Medieninteresse, nachdem ihre Eltern öffentlich erklärt hatten, dass sie keine Afroamerikanerin sei. Von ihrem Amt als NAACP-Vorsitzende trat sie daraufhin zurück, von ihrer Funktion als Polizei-Ombudsfrau wurde sie wegen Fehlverhaltens entbunden. Ihr Vertrag als Lehrbeauftragte wurde nicht verlängert.
Recht aussagekräftig ist hier ein Foto aus ihrer Jugend und ein Foto aus ihrem Leben als Schwarze.

Rachel Dolezal
Auf dem rechten Foto ist sie weiß wie frisch gefallener Schnee, auf der linken Seite ist sie etwas dunkler und hat einen Afro.
Rachel Dolezal gab an, dass sie „innerlich schwarz“ sei und brachte dazu den Begriff „transracial“ in Anlehnung an die Transsexualität. „Transrace“ läßt sich schwer übersetzen, „transrassig“ klingt im deutschen doch irgendwie unglücklich. Transethnisch? Mal sehen, ob sich da ein deutscher Begriff etabliert.
Die Wikipedia enthält dazu und ihrem Verständnis einige interessante Passagen:
Nach eigenen Angaben fühlte sich Donezal schon seit ihrer Kindheit als Schwarze. Sie habe Selbstportraits mit einem braunen statt einem pfirsichfarbenen Stift gemalt.[17]. Dolezal bezeichnete sich als „eindeutig nicht weiß“. Nichts am „Weißsein“ beschreibe, wer sie sei. Sie verglich sich mit dertranssexuellenCaitlyn Jenner (früher Bruce Jenner) und sagte, sie habe geweint als sie von deren Geschichte gehört habe.[10]
2010 hatte sich einer der Adoptivbrüder Dolezals von den Eltern losgesagt und Rachel Dolezal wurde mit dem Einverständnis der Eltern als dessen Vormund eingesetzt.[15] Dolezal gab allerdings den Adoptivbruder zwischenzeitlich als ihren eigenen Sohn aus.[18]
Doležal hat sich bei ihrem politischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Engagement immer als Teil der schwarzen Community bekannt. Auf mindestens einer Bewerbung, so als Ombudsfrau der schwarzen Community bei der lokalen Polizei, hat sie ihre ethnische Herkunft (im Sinne des amerikanischen race) als Schwarze angegeben.[1][19] 2015 gab sie auf Facebook einen schwarzen Amerikaner als ihren leiblichen Vater aus.[15] Im Juni 2015 sagten ihre Eltern auf Nachfrage einer Zeitung aus, ihre Tochter würde sich mittlerweile als echte Afroamerikanerin ausgeben, was sie als Verfälschung ihrer Herkunft empfänden.[2] Zum familiären Bruch sei es bereits gekommen, als Dolezal ihre Eltern 2006 bei einer Jubiläumsveranstaltung ausgeladen habe.[20]
Dolezal hatte Medien gegenüber behauptet, als schwarze Bürgerrechtlerin Opfer mehrerer Hate crimes geworden zu sein und ihren Eltern öffentlich unterstellt, sie misshandelt zu haben.[7] Zudem habe ihr leiblicher Bruder sie sexuell missbraucht. Ihrem ehemaligen Ehemann warf sie in einem Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn vor, er habe sie gezwungen, gegen ihren Willen beim Dreh eines Sexvideos mitzumachen.[10] Auch habe ihr ehemaliger Mentor ihr sexuelle Gewalt angetan.[21] Die angeblichen Verbrechen wurden nie nachgewiesen. Die Coeur d’Alene Press, eine Lokalzeitung in Idaho, befragte ihre Eltern darauf und brachte die Kontroverse ins Rollen.[7][22] Sie hätte sich seit 2007 immer mehr mit der Afroamerikanischen Gemeinde identifiziert.[3] Der Vorgang wurde landesweit publik.[23] Jonathan Capehart unterstellte Dolezal, im Sinne einerBlackfacedarbietung rassistisch vorzugehen.[24] Das Vorgehen von Doležal wurde ebenso, insbesondere auf sozialen Netzwerken, parallel zu einer transsexuellen Geschlechtsidentität als transracial diskutiert.[25] Die NAACP teilte mit, sie stehe hinter dem Engagement von Dolezal und ihre racial identity habe keinen Einfluss auf ihre Eignung als Präsidentin der NAACP.[26] In Spokane selbst sind nur 1,9 Prozent der Einwohner als African-American ausgewiesen.[7]
Gegen Dolezal wird wegen möglichen Betrugs ermittelt.[20] Patrick Blanchard sieht bei Doležal und anderen angenommenen Identitäten das Problem, dass sie zwar ihr Schwarzsein aufgeben könne wie ein Styling, dies aber tatsächlichen Minderheitsangehörigen nicht möglich sei.[18] Kritik kam auch aus der schwarzen Community Deutschlands, wo viele Dolezals Verhalten als respektlos empfanden.[27]
Das Problem des „transracial“ ist sehr interessant, weil es aus meiner Sicht erheblich Unstimmigkeiten im „intersektionalen Feminismus“ bzw. den intersektionalen Gruppentheorien deutlich macht.
„Rasse“ und „Geschlecht“ sind beide nach diesen Theorien sozial konstruiert. Demnach muss es auch möglich sein, dass es einen „Transismus“ in beiden Bereichen gibt. Im Bereich der Transsexualität soll rein auf das soziale Geschlecht abgestellt werden, bei einer „transracial“ hingegen wird dies als „Blackfacing“ oder Aneignung gesehen und ein solcher Übergang für unmöglich gehalten. Aus meiner Sicht wäre eine Begründung nur dann stimmig, wenn sei darstellt, warum dieser Unterschied gemacht werden kann, ohne das er willkürlich erscheint. Das scheint mir bisher nicht zu gelingen.
a) Lösung des Problems nach den biologischen Theorien
In den Biologischen Theorien ist die Abgrenzung eigentlich recht einfach: Transexualität entsteht, weil das Gehirn nicht nach einer festen Bauzeichnung gefertigt wird, sondern während des Wachsens je nach bestimmten Hormonständen entschieden wird, ob Wachstumsplan A (weiblich) oder Wachstumsplan B (männlich) durchgeführt wird. Dadurch kann es dazu kommen, dass bei bestimmten Hormonständen zu bestimmten Zeiten ein „weibliches Gehirn“ in einem „männlichen Körper“ steckt oder andersherum. Die beiden Baupläne für Mann oder Frau stecken abgesehen von den Informationen auf dem Y-Chromosom jeweils in jedem Menschen, so dass wir eine „gemischte Veranlagung“ in uns tragen. Dabei haben die Geschlechter über Jahrhunderttausende eine Arbeitsteilung mit der Wahrnehmung verschiedener Aufgaben praktiziert, was auch im Gehirn unterschiedliche Selektionen bewirkt hat. Demnach ergeben sich auch unterschiedliche „Wachstumspläne“, die in Verbindung mit einem anderen „Bodyplan“ dazu führen können, dass der Transsexuelle sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt.
Bei einer potentiellen Transracial ist die Lage anders: Es gibt keine so klare Trennung nach Rassen, die doppelt (oder dann eben 5-20 fach, je nach dem, was man als Rasse ansehen möchte) in entsprechenden Wachstumsplänen gespeichert ist. Da sich die jeweiligen Rassen auch ansonsten nicht so grundlegend unterscheiden wie Mann und Frau ist nicht mit dem gleichen biologischen Unbehagen, in einem fremden Körper zu stecken, zu rechnen. Wenn Rachel Dolezal in irgendeiner Form „afrikanische Gene“ hat, dann würde es sich um eine Vermischung handeln, nicht um andere Baupläne. Angesichts ihres Aussehens ist dies nicht unbedingt wahrscheinlich, wobei das nichts sagen müsste, sie könnte eben bei „Aussehensgenen“ die weiße Seite abbekommen haben. Allerdings würde ich vermuten, dass es so viele Unterschiede im Gehirn, dass man sich biologisch als „Transracial“ fühlt, aus meiner Sicht nicht geben wird. Die Schwarzen, die unter weißen aufgewachsen sind, haben ein recht weißes Verhalten und scheinen sich damit wohl zu fühlen. Es ist zwar theoretisch möglich, ich würde hier aber einen sehr starken kulturellen Anteil erwarten
b) Lösung nach poststrukturalistischen Theorien bzw. im Intersektionalismus
In den poststrukturalistischen bzw. intersektionalen Theorien stehen sich in den jeweiligen Gruppen wie Geschlecht, Rasse, Schicht etc Gruppen gegenüber, die eine hat die Macht, die andere nicht und die Gruppe mit Macht hat Privilegien. Große Differenzierungen gibt es erst einmal nicht, wenn man einer Gruppe zugehörig ist, dann kann man als Mitglied der privilegierten Gruppe seine Privilegien nur hinterfragen, aber nicht ablegen, als Teil der Gruppe ohne Macht hat man damit Nachteile.
In diese Theorien passen Transsexuelle eigentlich nicht rein. Denn diese machen einen Wechsel und versuchen entweder in eine privilegierte Gruppe zu kommen oder aus der privilegierten Gruppe in die unterdrückte Gruppe zu kommen, letzteres sogar in größerer Zahl als andersrum.
Der „Vorteil“ ist, dass man sie, weil ihr Wechsel nicht akzeptiert wird, den „Machtlosen“ zuordnen kann: Der Geschlechterwechsel ist schwierig, weil wir sehr darauf geeicht sind, Geschlechter unterscheiden zu können und uns dies in den allermeisten Fällen keinerlei Probleme bereitet. Einen Mann in eine Frau zu verwandeln erfordert daher viele, sehr kostspielige Eingriffe. Halbe Lösungen sind dabei gefährlich, denn sie werden selten als schön wahrgenommen, weil Attraktivitätsmerkmale meist genau darauf ausgerichtet sind, dass man möglichst wenig Zuordnungen zum anderen Geschlecht findet, weil dies üblicherweise mit verminderter Fruchtbarkeit etc einhergeht. Das „rettet“ dann vielleicht wieder den jeweiligen Opferstatus und macht die Anerkennung leichter, dann aber paradoxerweise eben entgegen der Behauptung nicht als Mann oder Frau. Diese Probleme haben „Transracials“ weniger, weil Mischlinge aus Rassen dieser deutlichen Unterscheidung nicht ausgesetzt sind und auch häufig etwas exotisches haben, ohne zu fremd auszusehen, was eher zu einer gewissen Schönheit führt.
Das ist aber eigentlich nicht die Zuordnung innerhalb der Theorie, es ist eher die Praxis: In der Theorie gilt, sofern man sich nicht den Vorwurf, dass man ein TERF (Trans Exklusiv Radikal Feminist) ist, aussetzen will: Es ist jeder zu akzeptieren, wie er sein will: Wenn jemand eine Frau sein will, dann ist er eine Frau, wenn jemand ein Mann sein will, dann ist er ein Mann, weil eben alles nur soziale Konstruktion ist.
Und in dieser Einordnung ist eben Transracial schwer einzulehnen: Wenn Rasse auch nur eine Konstruktion ist, dann gibt es keinen Grund, dieses nicht auf die gleiche Weise aufzulösen: Wer Schwarz sein will, der soll schwarz sein etc.
Hier kommt der intersektionale Feminismus aber mit einem anderen Problem in Konflikt: Schwarz sein ist eine positive Gruppenidentität, die auf eine Weise ausgebaut wurde, dass die Übernahme von deren Werten Aneignung ist. Es wäre interessant, warum dies bei Geschlecht nicht so ist, man könnte ja auch dort anführen, dass ein eher sich weiblich verhaltender Mensch sich die „weibliche Kultur“ aneignet. Aber hier funktioniert die Zuordnung anders: Die weibliche Art ist gleichzeitig Ergebnis einer Unterdrückung und die Erlösung: Man kann sie nutzen, um zu erklären, warum Frauen keine Vorstandsmitglieder werden („weil sie nicht dazu erzogen werden, sich durchzusetzen und keine Vorbilder haben“) und warum Frauen Frieden bringen würden und alles besser machen würden („weil Frauen irgendwie friedlicher und sozialer sind“). Die Teile der schwarzen Kultur werden insoweit weniger als Elemente der Unterdrückung gesehen, weswegen sie abgeschirmt werden dürfen. Auch dies scheint mir eher die Praxis zu sein, logisch aus den Theorien folgt das nicht.
Und deswegen kann man auch in den meisten Artikel, die begründen, warum Transsexualität geht, transracial aber gar nicht, die Argumente finden, die häufig von anderer Seite, den TERFs, gegen Transsexuelle angeführt werden.
Hier beispielsweise:
One last strike against anyone claiming to be transracial: It only works one way. Only white people can claim to be another race on the inside and then “perform” that race because race operates with white as the default. Racial classifications are based on deviations FROM whiteness. Rachel could pay a Black woman to do her hair and then pick up some NARS bronzer and say “Look! I’m not white!” I can’t straighten my hair and put chalk on my face while saying “Look! I’m not Black!” Transracial as a concept is another extension of white privilege, with those people – firmly situated at the top of society – experiencing an overwhelming need to identify with some other culture to validate their misplaced feelings of oppression because of their affinity for said culture.
Ich bin sicher, dass ein Schönheitschirurg, dem man die Millionen gibt, die Catyln Jenner ihrem Chirurgen gezahlt hat, da durchaus in beide Richtungen einiges machen könnte: Die Haut weißer machen, die Nase operieren, andere Anpassungen vornehmen, eine Perücke etc.
Letztendlich ist es aber auch deswegen ein schlechtes Argument, weil man eben sehr, sehr sehr, vielen Transsexuellen ihre Transsexualität ansieht. Gerade Männern, die sich als Frau ausgeben wollen, schon wegen des Adamsapfels und der anderen Gesichtsform. Asiaten haben vielleicht mehr Glück, weil sie eh weniger Testosteron haben und häufiger zartere Gesichter, aber der Übergang bleibt doch meist deutlich sichtbar. Und auch hier würde man wohl im Feminismus nicht sagen: „Alle merken, dass du ein Mann bist, nur weil du dich mit uns identifizieren willst und deine falsch platzierten Gefühle der Unterdrückung ausleben willst, müssen wir dich nicht als Frau akzeptieren“.
Oder aus diesem Artikel:
Und der Vergleich mit Jenner hinkt auch an anderer Stelle. Der größte Unterschied ist: Transfrauen oder Transmänner erfinden keine Geschichten. Dolezal verleugnete hingegen ihre weiße Identität. Sie log: Sie gab an, in einem Zelt gelebt zu haben, gab einen schwarzen Mann als ihren Vater aus. Und sie profitierte persönlich und sozial davon, dass sie andere für schwarz hielten. Sie inszenierte sich durch Haare und Make-Up als Afroamerikanerin. Dolezal spielte schwarz. Das knüpft auch an die rassistische Praxis des Blackfacing an, die ihren Ursprung in den Minstrel Shows des 19. Jahrhunderts hat, in denen sich weiße Darsteller schwarz anmalten, um sich über Schwarze lustig zu machen – und ihnen ihre Selbstbestimmung und Stimme zu nehmen.
Natürlich inszenieren sich auch Transsexuelle mit Haaren und Make-up als das andere Geschlecht und man könnte das genauso als „Womanfacing“ oder „Manfacing“ bezeichnen. Natürlich werden auch Transsexuelle ihre Geschichte für ein gutes Passing anpassen. Hierzu auch ein dazu passender Kommentar einer Transsexuellen bei der Mädchenmannschaft:
vielleicht darf ich als Transfrau zu dem taz-Artikel etwas sagen. Dort heißt es zu dem Vergleich Dolezal-Jenner:
„Der größte Unterschied ist: Transfrauen oder Transmänner erfinden keine Geschichten. Dolezal verleugnete hingegen ihre weiße Identität. Sie log: Sie gab an, in einem Zelt gelebt zu haben, gab einen schwarzen Mann als ihren Vater aus. Und sie profitierte persönlich und sozial davon, dass sie andere für schwarz hielten. Sie inszenierte sich durch Haare und Make-Up als Afroamerikanerin. Dolezal spielte schwarz.“
Diese Begründung, die anderen entspricht, die ich bisher gelesen habe, ist Quatsch. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich Geschichten erfunden und gelogen habe, um so leben zu können, wie es meinem Selbstbild entspricht. Habe ich darum meine „männliche Identität“ „verleugnet“? Eine solche Identität hatte ich doch gar nicht, die wurde mir nur zugeschrieben. Und klar habe ich mich durch Haare und Make-Up und anderes als Frau „inszeniert“. Habe ich darum „Frau gespielt“? Schließlich habe ich auch durchaus mal davon profitiert (und das ausgenutzt), dass andere mich für eine Frau „hielten“ – ebenso wie ich in anderen Situationen daraus Nachteile hatte. Das gilt für Dolezal aber ebenso.
Insgesamt beruht diese Begründung auf einem essentialistischen Verständnis von weiß und schwarz, das im selben Atemzug für das Geschlecht (zu Recht) nicht akzeptiert wird.
Ich finde darum, dass die Frage, wo genau der Unterschied zwischen „transracial“ im Dolezalschen Sinne und transgender liegt, nicht ganz so leicht vom Tisch zu wischen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es da einen Unterschied geben muss. Aber wirklich begründen kann ich ihn bisher nicht.
Oder hier auch ein interessanter Artikel:
One major difference here is that trans folks face immense challenges when they come out. Simple tasks like getting identification and even using the restroom can be major obstacles because of a lack of understanding and education, along with a whole heap of bigotry. Transgender folks often face rejection from their friends and family upon coming out, leading to increased rates of suicide and depression within the community. And trans women, especially trans women of color, face greater risks when it comes to being victims of violence. According to GLAAD, in 2011, trans women were victims of 45% of all hate murders.
By comparison, Rachel Dolezal’s misrepresentation led to her professional gain. Not only was she appointed the head of her local NAACP, she also taught classes, sold artwork, and was a paid speaker under the guise of being a black woman. She positioned herself as an authority on racism, oppression, and the black experience despite not having lived or experienced it herself. Dolezal’s new identity also relied on fake parents, fake children, and, of course, darkening her skin and changing her hair to appear racially ambiguous.
Rachel Dolezal’s behavior has not only hurt and confused many, it has put her voice above members of the community she so desperately sought to support. Given all that, it’s easy to see why comparing Dolezal’s behavior to the trans people who face so much adversity to be who they are isn’t just hurtful, it’s not even on the same playing field.
Rachel Dolezal hatte anscheinend erhebliche Angst nicht als schwarz akzeptiert zu werden, sah also anscheinend auch ihr „Transsein“ als erhebliche Herausforderung an und als ihr „Transsein“ aufflog, sie also ihr „Coming out“ hatte, hat sie erheblichen Ärger bekommen. Der Hohn ist nicht zu vergleichen mit dem was Caitlyn erfahren hat: Ihre Transsexualität wurde insoweit überall positiv besprochen.
Und natürlich gibt es auch Transsexuelle, die daraus persönliche Vorteile hatten, etwa Raewyn Connell, die es als Mann wohl kaum so weit gebracht hätte im Feminismus. Auch hier stellt sich eine Transexuelle als Autorität in Hinblick auf Sexismus etc dar. Ich wüsste auch nicht, dass Transsexuellen ansonsten im Feminismus vorgehalten würde, dass sie die Erfahrungen als unterdrückte Frau nicht verstehen könnten, weil sie eben Männer wären.
Eine interessante, insoweit positive Besprechung in Hinsicht auf Transrace findet sich hier:
The argument against whites electing to present themselves as black seems to me strong and persuasive.
Out of the „awful lie“ that „there is an ingrained, fundamental difference between blacks and whites“, writes Jonathan Blanks in the Washington Post, American blacks „have forged a sense of community and culture in the country that created us“. Or, as Jamelle Bouie of Slate says, „To belong to the black community is to inherit a rich and important culture“. However, the character of the culture and the cohesiveness of the community reflect the dire fact that „to be racially black is to face discrimination and violence“. The trouble with whites opting in to a black identity, Mr Bouie suggests, is the probability that they are „adopting the culture without carrying the burdens“. Whites who choose to identify as black have the option of choosing to present themselves as white again. Most blacks have no such option, and must suffer the consequences of America’s longstanding and lingering culture of white supremacy no matter what. The clear implication is that someone who was once white, and could be white again, can never really share this experience, and therefore could never really be black.
This logic also applies cleanly to those who have, like Caitlyn Jenner, undergone a male-to-female gender transition. America’s legacy of legal and cultural sexism has yet to fully unwind. Men who identify as women generally cannot have shared the same experience of sexism as a typical biological female, nor have shared the distinctive experience of a biologically female body, which includes not only the joys and travails of potential and actual pregnancy and childbirth, but also a sense of vulnerability to overpowering male strength.
(…)
Like it or not, our culture’s rules about who is entitled to be counted as a member of this or that group are now in the process of renegotiation. There is no way not to find it confusing. It is confusing. But it ought not to surprise us too much that the rules governing inclusion in different categories of identity are evolving at different rates. A very particular history stands behind what it means to be a woman, or what it means to be black in America. We should expect to see the differences in those histories reflected in the nature and pace of change in the norms governing different categories of identity. (…)
It seems to me that Smith’s brand-new willingness to accept transgendered students is a measure of progress in the struggle for gender equality. It tells us that the gap between the lived experience of women and men has narrowed enough that today’s students at women’s colleges do not see the experience of someone who is biologically male, and who was once culturally identified as male, as so different that she cannot be accepted as a woman among women. Likewise, the breadth and intensity of resistance to the idea of whites identifying as blacks is a measure of how far we still have to go in the struggle for real racial equality. The gap between the lived experience of black and white Americans remains so wide, and so unjust, that the attempt of whites to cross the racial divide, and to live as blacks do, seems impossible. It is offensive for a white American to represent herself as black, for now, because it diminishes the enormity of that gap by implying that it has, in fact, been crossed.
Rachel Dolezal knew she needed to lie to be accepted as black. That’s not something we ought to be happy about. When the day comes that future Rachel Dolezals can tell the truth about their European ancestry and find themselves nevertheless embraced as black by the black community, it will mean that the experience of being black in America has changed immensely, for the better, and that America has finally begun to make good on a promise of equality which, from its inception up to today, has never yet been kept.
Leider wird die Debatte im deutschen Feminismus nicht geführt. Hier zeigt sich wieder die Angst im Feminismus nur keinen Fehler zu machen und gar als Rassist darzustehen, der Aneignung zulässt. Eine weiße Feministin könnte sich eh nicht dazu äußern. Und so viele farbige Feministinnen hat es eben in Deutschland auch nicht.
Gefällt mir Wird geladen …